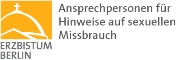Unterbrechung
Impuls zur Wochenmitte
Hoffnung ist eine der großen Botschaften des Christentums. Warum sie glauben und auf ein Mehr hoffen, erzählen hier Christinnen und Christen. Persönliche Glaubenszeugnises und mutmachende Gedanken in der Wochenmitte, um die Seele aufzutanken.
14. Februar 2024
Die Basis ist Respekt!
Die Basis jeden guten Witzes und jedes närrischen Treibens ist Respekt! Hass, Hetze oder Menschenfeindlichkeit haben im Karneval keinen Platz.
Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin
07. Februar 2024
Hoffnungsvoll in den neuen Tag
Was der Tag heute bringen wird an Herausforderungen, an Freude und Leid, weiß ich nicht. Aber mit einem Gott, der uns Menschen nicht fallen lässt, kann ich hoffnungsvoll in den neuen Tag gehen.
Prälat Dr. Stefan Dybowski
Leiter Orden und Geistliche Gemeinschaften im Erzbischöflichen Ordinariat
31. Januar 2024
Mein Herz schwebt
Ich finde dieses Bild wunderbar: Ich habe festen Boden unter den Füßen, ich bin getragen, sicher, habe ein starke Basis für mich und mein Leben. Und gleichzeitig schwebt mein Herz, meine Seele in luftigen Höhen. Ich lasse mich nicht runterziehen von der Schwere des Alltags. Mein Herz ist im Himmel zuhause.
P. Benno Rehländer
Pfarrei Bernhard Lichtenberg
24. Januar 2024
wesentlich und unverhandelbar
Ich habe mir für das noch neue Jahr vorgenommen, neu darüber nachzudenken, was für mich „das Wesentliche“ und Unverhandelbare ist und was vielleicht doch verzichtbar, um meinen persönlichen Beitrag dazu zu leisten, nicht nur einfach zu leben. Sondern einfach zu leben.
Carla Böhnstedt
Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin
17. Januar 2024
Hoffnung bewahren!
Wir dürfen das Vertrauen, dass es eine höhere Kraft gibt, die diese Welt hält, nicht verlieren. Dieser Gedanke hilft mir - trotz aller Ängste und Sorgen im Hinblick auf das neue Jahr - die Hoffnung zu bewahren, dass vieles bald auch wieder besser wird.
Marcel Reuter
Pastoralreferent
20. Dezember 2023
Freut euch!
Freut euch!, sagt der gestrige 3. Advent. Ich finde es interessant, inmitten einer Zeit, die für viele Menschen vermutlich zu der schönsten im Jahr zählt, darauf hingewiesen zu werden, sich zu freuen. Es kommt mir vor wie eine Aufforderung, eine Erinnerung. Als bräuchten wir den Hinweis: Freut euch doch mal über das, was ihr habt! Schätzt es und seid dankbar!
Cäcilia Montag
Leiterin der Stabsstelle Seelsorge der Caritas Berlin
13. Dezember 2023
Die Zeit des Wartens
Advent. Die Zeit des Wartens - bis endlich Weihnachten ist. Und dann? Worauf genau warten wir eigentlich? Worauf warte ich? Ich möchte die vor mir liegende Adventszeit nutzen, um darüber nachzudenken. Wir erwarten schließlich nicht weniger als das "Licht der Welt", einen "Friedensfürsten".
Johannes Rogge
Rundfunkbeauftragter im Erzbistum Berlin
06. Dezember 2023
Das Licht im Advent
Mich trägt ein besonderer Brauch durch den Winter: Das Licht in der Adventszeit. An Weihnachten empfangen wir das Licht der Welt und ob es uns bewusst ist oder nicht, eben jenes Licht senden wir auch wieder in die Welt hinaus. Es zeigt uns, dass wir nicht verzagen müssen, sondern Schönheit und Hoffnung finden, wo sie vorher nicht zu sehen war.
Lea-Katharina Sabol
Abendsegen-Sprecherin
29. November 2023
Kirche muss offen sein!
Jesus hat die Menschen eingebunden, Wege eröffnet und nicht verschlossen, geheilt und nicht verletzt, manche feststehenden Gesetze und Verbote infrage gestellt, Besserwisser sowieso. (...) Ich denke, Kirche muss offen sein: Für Kirchenmitglieder oder Ausgetretene, Gläubige und Spaziergänger… alle sollen spüren können, dass Kirche ihnen Raum gibt.
Mathias Laminski
Pfarrer der Pfarrei St. Josef Berlin-Köpenick
22. November 2023
Du gehörst mir!
Ich kann ihm nicht verlorengehen. Selbst wenn ich mich einmal selbst verlieren sollte, Gott sagt immer noch „Du gehörst mir. Ich bin bei dir.” oder wie mein kleiner Neffe sagen würde: „Meins”.
Dompropst Tobias Przytarski