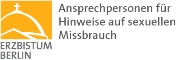Unterbrechung
Impuls zur Wochenmitte
Hoffnung ist eine der großen Botschaften des Christentums. Warum sie glauben und auf ein Mehr hoffen, erzählen hier Christinnen und Christen. Persönliche Glaubenszeugnises und mutmachende Gedanken in der Wochenmitte, um die Seele aufzutanken.
06. September 2023
"Nur im Dunkeln sieht man die Sterne."
Martin Luther King hat einmal gesagt:
„Nur im Dunkeln sieht man die Sterne.“
Diese Worte erinnern mich daran, dass wir manchmal nur in dunklen Zeiten klar sehen: Was ist mir wirklich wichtig und was raubt mir nur Energie? In der Finsternis nämlich liegt auch die Kraft des Loslassens und für den Neuanfang..
Isabelle-Marie Galioit
Multimedia-Redakteurin im Erzbistum Berlin
30. August 2023
"Herzensbildung"
Neben der Sammlung von Wissen ist aber auch etwas anderes wichtig: die Herzenbildung. Oder etwas altmodischer ausgedrückt: Neben das Wissen muss auch das Ge-wissen treten.
Joachim Opahle
Theologe und Geschäftsführer des Filmfestivals Belief on Screen
23. August 2023
"An Deiner Seite"
Ich wünsche Dir, dass Du spürst, dass es einen Gott gibt, der an Deiner Seite ist und Dich in guten und weniger guten Momenten begleitet.
Mathias Laminski
Pfarrer der Pfarrei St. Josef Treptow-Köpenick
16. August 2023
"Wir sind nicht allein"
In Jesus ist Gott selbst vom Berg herabgestiegen. Er hat seine Komfortzone verlassen. Auch wir sollen uns nicht zurückziehen in unseren Glauben. Wir sollen zurück, runter ins Leben, auf Augenhöhe mit den anderen. Und das Wunderbare ist: Auch wenn der Urlaub vorbei ist, brauchst du vor dem Weg zurück keine Angst haben. Es geht leichter, die Schritte sind sicherer und wir gehen in der Gewissheit, wir sind nicht allein.
Christoph Kießig
Bereich Pastoral - Erzbischöfliches Ordinariat
09. August 2023
"Gottes Segen auf allen Wegen"
„Gottes Segen auf allen Wegen!“ – das bedeutet auch: Sollte doch etwas passieren, wünsche ich Dir von Herzen einfühlsame Menschen, die es gelernt haben, Verständnis zu zeigen und deshalb gerne weiterhelfen.
Harry Karcz
Pfarrer der Pfarrei St. Maria - Berliner Süden
02. August 2023
"Gott ist ein treuer Begleiter"
Gott ist ein treuer Begleiter, der uns Menschen nicht allein lässt. Mag sein, dass wir ihn manchmal nicht wahrnehmen, weil sich etwas wie eine Wolke zwischen uns geschoben hat. Aber irgendwann wird er sich wieder bemerkbar machen.“
Stefan Dybowski
Leiter Orden und Geistliche Gemeinschaften im Erzbischöflichen Ordinariat
26. Juli 2023
"Freundlich, hilfsbereit, stets auf das Gute bedacht"
Freundlich, hilfsbereit, stets auf das Gute bedacht – schon die ersten Christinnen und Christen sind an diesem hohen Anspruch gescheitert! Bei allem guten Willen – es gelingt einfach nicht. Immer wieder wächst Unkraut in unserem Herzen. Jesus hat das gewusst. Darum hat er nicht von einer Gemeinschaft der Reinen und Superfrommen gesprochen, sondern davon, dass sein Vater barmherzig, geduldig und liebevoll auf uns Menschen schaut.
Thomas Brose
Professor für Philosophie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Berlin, Sprecher von „Das Wort“
19. Juli 2023
"Sucht ihn immer, und ihr werdet ihn immer finden"
Es gibt einen Gedanken, der mich in meinem Leben begleitet. Der heilige Vinzenz Pallotti sagte einmal: "Sucht Gott, und ihr werdet ihn finden. Sucht Gott in allen Dingen, und ihr werdet ihn in allem finden. Sucht ihn immer, und ihr werdet ihn immer finden.
Benedikt Zimmermann, Pastoralreferent im Erzbistum Berlin
12. Juli 2023
"Gott will konkret geliebt werden"
Gott will nicht einfach nur gedacht, wissenschaftlich bewiesen oder bezweifelt werden, sondern konkret geliebt.
Lissy Eichert, Pastoralreferentin und Sprecherin des "Wort zum Sonntag"
05. Juli 2023
"Sorgt euch also nicht um morgen"
Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir alles in uns haben, um die ungeplanten Überraschungen des Lebens zu meistern. Im Matthäus-Evangelium ermutigt uns Jesus: „Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.“
Felicitas Richter, Rednerin, Trainerin und Coach