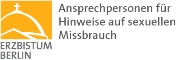Die goldene Stunde
Reflexionen aus der Krankenhausseelsorge
Das Kunstwerk „Die goldene Stunde“ von Renate Wolff hängt gegenüber dem Bettenhochhaus der Charité Mitte und ist eine Reflexion über die goldene Stunde, die in der Notfallmedizin den Zeitraum bezeichnet, in dem sich entscheidet, ob ein Patient gerettet werden kann. In dem Kunstwerk spiegelt sich das Bettenhochhaus. Von den Fenstern aus, können Patientinnen und Patienten auf das Bild schauen. Menschen hoffen für sich auf die rettende, goldene Stunde, wie wir in dieser Zeit auch gemeinsam auf die Stunde warten, in der die Krise der Pandemie bewältigt sein wird.
11 Monate Pandemie. Zeit für ein paar Reflexionen.
Im März 2020 standen mit einem Mal Sicherheitsleute an den Eingängen der Charité. Besuche waren eingeschränkt oder verboten. Für die Seelsorgerin war der Zutritt jedoch immer möglich. Der Ausweis wurde zu einem wichtigen Requisit. Ich hatte Zugang zu allen Stationen. Ich besuchte Menschen, die ihre Angehörigen vermissten, Schwerkranke, die lange Zeit auf der Intensivstation verbrachten und die Ermutigung brauchten, begleitete Sterbende und ihre Angehörigen. Und bekam mit, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ging. Denn die Belastung gerade für sie ist extrem hoch.
Auf den Menschen kommt es an
Systemrelevant, keine Frage! An erster Stelle werden Pflegende und Ärzte genannt. Dem Gesundheitssystem mangelte es schon vor der Corona-Krise an Personal aus vielen Gründen. Nun weiß man: Wenn Krankenhäuser überlastet sind, dann liegt es nicht daran, dass wir nicht noch mehr Stationen eröffnen könnten, mehr Beatmungsgeräte besorgen, ja sogar neue Kliniken aufmachen – es kommt auf den Menschen an! Wir brauchen Pflegende und Ärzte, ihre Professionalität, ihr Können, und damit verbunden ihre Menschlichkeit. Sie fehlen und sie sind eben keine „Mangelware“, die man irgendwie mal beschaffen kann. Es sind sie, die nun an der Grenze ihrer Belastung arbeiten unter den schon schwierigen Bedingungen mit Personalknappheit, jetzt auch noch denen größerer Schutzanforderungen, was wiederum Zeit, Anstrengung und Schweiß kostet. Und sie sind es auch, die darunter leiden, wenn sie unter diesen Anforderungen ihrer eigenen Anforderung an eine professionelle, dem Menschen zugewandte und seine Würde anerkennende Pflege kaum nachkommen können. Sie erleben, wie Menschen, die sie pflegen, sterben; die Todesfallzahlen sind für sie Menschen mit Namen und Gesicht. Sie sind da, wenn Menschen sterben und ermöglichen noch eine Begegnung mit Angehörigen und Seelsorger/-in.
So schwer dies alles ist, eines macht uns diese Situation deutlich: Es kommt nicht auf das System an (davon gibt es viele und nicht alle dienen vor allem der Menschlichkeit) – es kommt auf den Menschen an. Das Wort systemrelevant impliziert, dass wir den Menschen nach seinem Nutzen für ein System bewerten, auch wenn er nicht danach bezahlt wird. Zum Glück für uns machen diese Menschen wiederum ihre Arbeit nicht abhängig vom Nutzen eines Menschen, sondern orientieren sich an seiner Würde. Systemrelevant, das ist für mich ein Hilfsbegriff in der Pandemie, der aber sehr wohl in die Irre führen kann. Für die Menschen relevant, auf die Menschen bezogen und ihnen dienend das sollten wir sein und sein wollen. Das könnte ein Wegweiser sein in die Richtung, in die wir denken und handeln sollten, wenn wir eine Lehre aus dieser Pandemie ziehen wollen. Da müssen wir als Krankenhausseelsorger/-innen auch tätig werden über die Einzelseelsorge hinaus und uns einsetzen für ein Gesundheitssystem, das nicht die Ökonomie, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
»Wir als Krankenhausseelsorger/-innen müssen auch tätig werden über die Einzelseelsorge hinaus und uns einsetzen für ein Gesundheitssystem, das nicht die Ökonomie, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt. «
Der Mensch in seiner Begrenzung und Verwiesenheit – Sterben in Zeiten von Corona
In den letzten Monaten wurde ich als Seelsorgerin vermehrt zu Sterbenden gerufen. Das Schicksal der an Corona erkrankten, daran Versterbenden und deren Angehörige ist mehr als eine vom RKI täglich genannte Zahl. Es sind Gesichter, Tränen, Fassunglosigkeit, Trauer, Nicht-verstehen. Vor Weihnachten überlege ich mir, wie das in Kirchen vorkommt? Ich fühle mich etwas außen vorgelassen, zusammen mit den Betroffenen, die, in all den Überlegungen, wie, mit wem und wo Weihnachten gefeiert wird, nur wissen, dass sie es ohne ihre Lieben erleben müssen.
Ganz am Anfang des ersten Lockdowns habe ich meine Patientinnenverfügung erneuert und die Vorsorgevollmacht unterschrieben. Gleich die ersten Begegnungen mit Covid19-Schicksalen machte mir deutlich, dass es sehr plötzlich und sehr schnell gehen kann. Seelsorge ist nur auf Augenhöhe möglich. Dazu gehört, sich selbst als gefährdet und begrenzt zu erkennen. Sind wir bereit, mit den Menschen über unsere Endlichkeit und Begrenztheit zu sprechen? Dann werden wir mit ihnen auch über unsere Hoffnung reden können. Das kommt im Krankenhaus übrigens gar nicht so selten vor. Aber da kann man ja nicht so leicht vor der eigenen Realität und der des Gegenübers davonlaufen.
Gebetsorte
Selten habe ich an Krankenbetten, in meinem Büro sogar am Telefon so viel gebetet wie in der letzten Zeit. Die Welt braucht viel Gebet – und wenn wir es nicht in die Kirchen einsperren, dann breitet es sich eben überallhin aus. Papst Franziskus hat einmal davon gesprochen, dass Jesus anklopft, aber von innerhalb der verschlossenen Kirchentür, damit wir ihn endlich hinausließen zu den Menschen. Dazu müssen wir zu den Menschen gehen, an die Orte, wo sie leiden, fragen, Hoffnung suchen. Krankenseelsorge und Krankenhausseelsorge gehört damit unbedingt zum Kern kirchlichen Handelns. Die heilenden Begegnungen Jesu sind uns Beispiel und Verpflichtung in seiner Nachfolge.
Seelsorge geht nicht allein und nicht ohne gute Strukturen
Da sein, ansprechbar sein gehört zu den Grundlagen der Krankenhausseelsorge. In den Zeiten der Kontaktbeschränkung, des Abstandshaltens wird das noch wichtiger. So versuche ich, auch wenn andere ins Homeoffice gehen, wirklich vor Ort, im Krankenhaus zu sein. Ich merke, dass das honoriert wird, von Patient/-innen, die eine verlässliche Anlaufstelle haben, für Angehörige, die nicht am Anrufbeantworter landen, für Mitarbeitende, auf deren Anruf ich schnell reagieren kann und auch für das oft übersehene Servicepersonal. Als eine der Reinigungskräfte mich am frühen Morgen aus der Klinik gehen sieht, sagt sie mir: „Wenn Sie heute Nacht da waren, dann bleiben Sie aber heute mal zu Hause.“ Seelsorge für die Seelsorge. Deutlich wird mir aber auch, wie sehr stützende Strukturen fehlen. Notrufdienste, Vertretungen, Repräsentanz – all das muss jetzt oft individuell und spontan geregelt, muss improvisiert werden. Und manches ist auch während einer Katastrophe nicht zu schaffen und misslingt. Das ist ermüdend.
Klinikseelsorge ist eben mehr als nur das nette Gespräch, sie braucht, um professionell und qualitätsvoll zu sein den entsprechenden Rahmen und passende Strukturen, dazu gehören auch Teams, in denen wir uns gegenseitig stützen können. Das hat mir besonders gefehlt. Das sollten wir in Angriff nehmen, sobald wir wieder genug Luft dafür haben.
Nicht unerwähnt soll aber die Dankbarkeit bleiben für spontane Telefonate, in denen wir uns entlasten und freundschaftlich kollegial helfen konnten und für die Vertretungen und Dienste, die freiwillig übernommen wurden, ohne dass es eine Verpflichtung dafür gegeben hätte. Das hilft sehr.