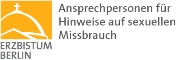26.000 Katholiken, eine Pfarrei – muss das tatsächlich sein? Das fragen sich nicht wenige im Erzbistum. Über Sinn und Perspektive von Pastoralen Räumen sprach Alfred Herrmann mit Erzbischof Heiner Koch für die Zeitung zum Pastoralen Prozess „Auf den Weg“. Sie liegt ab diesem Wochenende wieder in den Kirchen aus und dem „Tag des Herrn“ bei.
Frage: Wie beurteilen Sie den Stand des Prozesses „Wo Glauben Raum gewinnt“?
Erzbischof Koch: Wir sind auf einem wirklich guten Weg, der von vielen Ehren- wie Hauptamtlichen mit großem Interesse gegangen wird. Gleichzeitig spüre ich in den vielen Gesprächen mit den Menschen vor Ort, dass der Fusionsprozess von vor gut zehn Jahren, als das Erzbistum sparen musste, eine fast traumatische Belastung darstellt. Das macht kreatives, zukunftsorientiertes Denken schwer. Wir müssen daher noch viel mehr verständlich machen, worum es bei diesem Weg eigentlich geht.
Und worum geht es aus Ihrer Sicht bei diesem Weg?
Wir machen den Pastoralen Prozess nicht, um Gemeinden zusammenzuschließen und so Personal und Geld einzusparen, sondern um Antworten auf die Frage zu finden: Wie erfüllen wir als Kirche heute den Auftrag Jesu: „Macht diese Menschen zu meinen Jüngern“? Wie machen wir der Gesellschaft bewusst: Jesus Christus ist da? Das ist unsere Hauptaufgabe.
Wie hilft da ein Pastoraler Raum?
Die traditionellen Wege der Weitergabe des Evangeliums an die Menschen greifen nicht mehr. Wir müssen neue Wege gehen. Die Kirche ist in ihrer ganzen Breite gefragt, Gemeinden, Orden, Verbände, Beratungsstellen, Krankenhäuser, Schulen. Wir haben uns mit unseren unterschiedlichen Talenten und Begabungen gemeinsam diesem Auftrag zu stellen. Kirche ist Gemeinschaft. Kirche ist Communio. Es braucht den Esprit, die Kreativität, die Dynamik, die Phantasie, das Sich-Ergänzen, das Kritisch-Sehen, das Wach-Sein eines ganzen Pastoralen Raums.
„Sonst bleibt der Prozess eine Strukturreform und wir können ihn uns sparen.“
Wo liegen Hindernisse?
Viele von uns zeigen enormen Einsatz, um ihre Gemeinschaft zu erhalten, gleichzeitig überlegen sie zu wenig: wie gehen wir mit den anderen um, die Tür an Tür mit uns leben und die wir nicht kennen? Ich lasse mir gerne vorrechnen: Wieviel Prozent des Haushalts gebt ihr für missionarische Tätigkeiten aus und wieviel zum Selbsterhalt? Wieviel personelles Engagement investiert ihr, um das Gemeindeleben zu erhalten, und wieviel, um die Menschen draußen zu erreichen? Ich will damit einen Perspektivwechsel erreichen.
Wo fängt missionarische Gemeinde an?
Jede Beerdigung, jede Trauung, jede Taufe bildet eine Chance, Wenig- oder Nicht-Glaubende anzusprechen. In jedem Kindergarten, jedem Krankenhaus kommt es zu zahlreichen Begegnungen mit glaubensfremden Menschen. Liegt mein Fokus darauf, sie anzusprechen? Vor Firmungen wird mir oft gesagt, die Gemeinde kommt heute nicht, weil es sonst zu voll wird. Warum nicht? Die Gaben des Geistes werden in den Firmlingen geweckt und zwar für die Gemeinde. Wäre es da nicht toll, die Gemeinde hieße die vielen Gäste, die oft kaum Kontakt zur Kirche haben, schon an der Tür willkommen?
Wie können Gemeinden den Wandel zu mehr Öffnung schaffen?
Das ist eine Mentalitätssache. Habe ich erstmal unsere Hauptaufgabe „Macht diese Menschen zu meinen Jüngern“ verinnerlicht, kann ich aus dieser neuen Perspektive heraus alles anders machen. Das beginnt bereits beim Alltäglichen. Gestalte ich den Kirchenraum mit Blumen, mit Kerzen so, dass Besucher spüren, hier leben Leute, denen diese Kirche viel bedeutet? Begleite ich Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiten? – Erstaunlich ist, dass es in manchen Gemeinden jedes Osterfest erwachsene Täuflinge gibt und in anderen nie. – Welche Möglichkeiten bietet mir die Erstkommunion - da ist ein Elternteil in der Kirche, das andere ungetauft? Lade ich zu Religiösen Kinderwochen nur die Kinder der Gemeinde ein oder auch die ungetauften aus der Nachbarschaft? Betet eine Gemeinde auch für die, die nicht da sind?
Um den Schalter umzulegen, dabei hilft der Pastorale Prozess?
Ich hoffe! Sonst bleibt der Prozess eine Strukturreform und wir können ihn uns sparen.
„Dass viele um uns herum nichts von Gott und Jesus Christus hören, muss uns eigentlich alle kribbelig machen.“
Welche Vision haben Sie von den künftigen neuen Pfarreien?
Wir sind als Kirche nicht dazu da, uns in einem Schrebergarten fern der Welt behaglich niederzulassen, sondern wir sind für die Menschen in dieser Welt da. Dass viele um uns herum nichts von Gott und Jesus Christus hören, muss uns eigentlich alle kribbelig machen. Es gilt daher, den gesellschaftlichen Raum, in dem wir leben, wahrzunehmen, und zwar nicht nur jetzt im Prozess, sondern ständig, und dann zu überlegen, wie wir den Menschen in diesem Raum helfen können, zu leben und den Glauben zu finden. Das ist der Inhalt der neuen Pfarrei.
So mancher befürchtet, dass Kirche im Pastoralen Raum die Nähe zu den Menschen verliert...
Momentan denken immer noch viele, wir entwickeln mit den Pastoralen Räumen nur große Einheiten, die das Leben der kleinen einschränken. Da sage ich nur: Wenn eine größere Einheit nicht in sich viele kleine Gemeinschaften bildet, dann fehlt das Wesentliche, dann geht der Prozess daneben. Die neue Pfarrei ist eine Gemeinschaft von Gemeinschaften. Ich möchte, dass künftig deutlich mehr Gemeinden und Orte kirchlichen Lebens in einer Pfarrei entstehen, viel mehr örtliche und überörtliche Communio. Pulsierendes Leben soll sichtbar werden.
Also mehr Nähe und mehr Gemeinde?
In vielen Ortschaften unseres Erzbistums gibt es keine Kirchen. Dort leben vielleicht 15, vielleicht 20 katholische Christen, die nie Pfarrei waren und niemals werden. Aber diese 15 Katholiken sind da und sie sollen das Katholisch-sein, ihren Glauben in ihrem Dorf, in ihrer Kleinstadt leben und mit den anderen aus den benachbarten Dörfern und Städten Gottesdienst feiern. Wenn der Bürgermeister zum Fest einlädt, zeigen sie: „Wir 15 sind die Katholiken hier“. Der Prozess möchte also die Präsenz vor Ort intensivieren und nicht zerstören.
Einige sehen im Prozess die Chance, alte Fusionen umzukehren und sich als Gemeinde in einer neuen Pfarrei wieder stärker zu separieren?
Im Pastoralen Prozess geht es um Öffnung, um Miteinander und um Verantwortung füreinander. Ich glaube, dass wir bisher zu viel Separierung haben. Das betrifft nicht nur die Gemeinden, sondern auch die Orte kirchlichen Lebens. Isolierte Welten, Inselwelten, das ist nicht die Zukunft.
Andere sehen wiederum die Möglichkeit, zu zentralisieren…
Es gibt sicherlich Dinge, die man zusammenführen kann. Das gilt für die Verwaltung wie auch für den pastoralen Bereich. Wenn in einer Gemeinde im Jahr ein Paar heiratet und im gesamten Pastoralen Raum vielleicht zehn Paare, dann ist es sinnvoll, die Ehevorbereitung zu zentralisieren. Dabei darf man weder Angst vor Zentralisierung haben noch darin ein Allheilmittel sehen. Es ist, ganz pragmatisch, eine Möglichkeit.
„Es geht um das Gefühl: Wir haben ein gemeinsames Zentrum“
In der neuen Pfarrei soll es eine zentrale Pfarrkirche geben, die auch das Patrozinium bestimmt. Also doch Zentralisierung?
Die Pfarrkirche als Ort Christi, an dem die Gläubigen aus allen Gemeinden zusammenkommen, ist mir wichtig, wie auch ein gemeinsamer Name, weil sie zeigt: „Wir gehören zusammen“. Wenn die Pfarrkirche jedoch genutzt wird, um andere kleinzumachen, um nur noch dort die Hauptgottesdienste zu feiern oder gar als Grund, Kirchen zu schließen, wäre das völlig abstrus. Es geht um das Gefühl: „Wir haben ein gemeinsames Zentrum“ – und das ist nicht ein Gremium oder ein Zentralbüro, sondern eine Kirche. Das ist ein großes Glaubenszeugnis und etwas anderes als Zentralisierung.
Haben Sie in letzter Zeit etwas von dem erlebt, was Sie von „Wo Glauben Raum gewinnt“ erhoffen?
Beim Gottesdienst der Familienfreizeit jetzt im August in Zinnowitz kam bei der Kommunion ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern auf mich zu. Ich wollte den Eltern gerade die Kommunion geben, da sagte das Paar: „Wir sind alle vier ungetauft – haben Sie dennoch einen Segen für uns?“ Diese Familie war nur da, weil sie von Freunden zur Freizeit eingeladen wurde, nicht um gläubig zu werden, sondern um dabei zu sein. Aber in den 14 Tagen haben sie bereits etwas gespürt. Das bewegt mich sehr. Das wäre nicht zustande gekommen, hätte niemand daran gedacht, auch sie anzusprechen.
<link file:32417 _blank>Zur neuen Ausgabe von „Auf dem Weg“