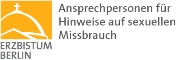Geschichte des Erzbistums
Das Bistum Berlin, 1930 als „Tochter“ von Breslau errichtet, ist noch sehr jung. Es liegt auf dem Gebiet der ehemaligen Bistümer Brandenburg, Havelberg, Kammin und Lebus. Heute umfasst das Bistum, das am 8. Juli 1994 zum Erzbistum erhoben wurde, Berlin, weite Teile Brandenburgs und Vorpommern.

Geschichtlicher Überblick
Brandenburg und Pommern wurde erst relativ spät missioniert. Dies ist untrennbar verbunden mit den zwei Missionsreisen, die Bischof Otto von Bamberg (1124/28) unternommen hatte. Danach begann eine Zeit blühenden kirchlichen Lebens.

1930
Bistumsgründung
Am 14. Juni 1929 wurde in Berlin der Vertrag des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhl, das sogenannte Preußenkonkordat, unterzeichnet. Darin heißt es:
„Der bisher dem Bischof von Breslau mitunterstehende Delegaturbezirk Berlin wird selbständiges Bistum, dessen Bischof und Kathedralkapitel bei St. Hedwig in Berlin ihren Sitz nehmen.“ (Art. 2)
Am 9. Juli 1929 billigte der Preußische Landtag mit 243 zu 171 Stimmen das Gesetz zum Konkordat. Zustimmung kam von den Regierungsparteien SPD, Zentrum und DDP; die Gegenstimmen vor allem von den Kommunisten und den Nationalsozialisten.

1933
Das Bistum unter dem Hakenkreuz
Unterzeichnung des „Reichskonkordats“ durch Kardinalstaatssekretär Pacelli und Vizekanzler von Papen im Vatikan,
Juli 1933
Die Ratifizierung des umstrittenen Vertrages, von dem sich die Kirche Rechtssicherheit versprach, erfolgte am 10. September 1933. Am selben Tag verbot Propagandaminister Goebbels eine angekündigte Rundfunksendung über die Trauerfeiern für den verstorbenen Berliner Bischof Schreiber. Am 17. September hielt Nuntius Orsenigo in der Berliner Kathedrale einen Dankgottesdienst zum Konkordatsabschluß, und in einem Grußtelegramm an Reichskanzler Hitler versicherten Kapitularvikar Steinmann und Dr. Klausener namens der Katholische Aktion, „alle Kräfte für Volk und Vaterland einzusetzen“. Trotz gegenteiliger Erfahrungen, trotz Verboten von katholischen Verbänden und Repressionen gegen Regimegegner hoffte man noch, Hitler werde die in seiner Regierungserklärung vom 28. März 1933 gegebene Zusicherung einhalten, die Rechte der Kirchen zu respektieren.

1940-1945
Einsatz für Verfolgte
„Wer immer Menschenantlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine irdische Gewalt nehmen darf.“
(Bischof Preysing in dem Adventshirtenbrief 1942)
Wie überall in Deutschland und in Europa hinterließ das „Dritte Reich“ im Bistum Berlin eine blutige Spur des Todes und mannigfacher Verwüstung, aber es gab viele mutige Frauen und Männer, die ihr Leben verloren im Einsatz für Verfolgte.

1945
Wiederaufbau
Die Trümmer der Charlottenburger St. Canisius-Kirche 1945 und der damals spektakuläre Neubau der Kirche von 1955 (1995 durch Brand erneut zerstört, Neubau 2002 geweiht). Während in West-Berlin ungehindert Kirchen in neuen Wohngebieten gebaut werden konnten, war in Ost-Berlin zwar die Beseitigung von Kriegsschäden an Kirchengebäuden möglich. Bis zum Jahr 1983 genehmigte das SED-Regime jedoch lediglich einen einzigen Kirchenneubau, in Berlin-Biesdorf-Nord.

1949 - 1989
Unter der politischen Spaltung
Der letzte gesamtdeutsche Katholikentag vor dem Mauerbau von 1961 fand vor dem Hintergrund zunehmender politischer Spannungen statt. Die Katholiken in der DDR und in Ost-Berlin sahen sich immer neuen Schikanen ausgesetzt. Das verfassungsmäßig noch garantierte Recht auf Religionsunterricht in den Schulen wurde weiter eingeschränkt. Im Frühjahr 1958 wurde das katholische Kinderheim in Stralsund durch DDR-Behörden zwangsgeräumt. Im Sommer erfolgte die Verhaftung von Katholiken aus Rathenow und Jesuiten aus Ost-Berlin unter dem Vorwurf der „Spionage“.

1949 - 1989
Lebendige Kirche in Ost und West
Die katholischen Schulen in West-Berlin waren nicht nur bei katholischen Eltern und Schülern immer gefragt. In Ost-Berlin und in der DDR blieb den Kirchen die Gründung von Schulen aus ideologischen Gründen verwehrt. Einzige Ausnahme war die durch alliiertes Recht geschützte Theresienschule, wenngleich auch ihre Existenz staatlicherseits oft bedroht war.

1989
Der Weg ist frei
Zu allen Zeiten ist es Auftrag der Kirche, als glaubwürdige Zeugin des Evangeliums ihre Sendung und ihren Dienst für die Menschen zu verwirklichen. In den Jahren 1971-1975 wirkten Delegierte aus den Gemeinden in West-Berlin an der Würzburger Synode, Delegierte aus dem Ostteil des Bistums an der Dresdner Pastoralsynode mit. 1987/88 fand im Westteil ein Pastoralkongreß statt. Für die Kirche von Berlin, die unter der politischen Spaltung besonders gelitten hat, war das Ende von Mauer und Stacheldraht Anlaß zu großer Dankbarkeit und von Zuversicht getragener Aufbruchstimmung.

1996
Papst Johannes Paul II. in Berlin
Während eines Gottesdienstes am 23. Juni 1996 im Berliner Olympiastadion nahm Papst Johannes Paul II. die Seligsprechung von zwei NS-Opfern vor: Dompropst Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner (1915-1945), der als Diakon 1939 verhaftet und im KZ Dachau eingesperrt wurde, wo er durch einen inhaftierten französischen Bischof heimlich die Priesterweihe empfing; kurz nach der Befreiung starb er an den Folgen der Haft.

2011
Papst Benedikt XVI. in Berlin
Papst Benedikt XVI. beendete am Sonntagabend, dem 25. September 2011 seinen viertägigen Deutschlandbesuch. Erzbischof Dr. Rainer Maria Woelki dankte Papst Benedikt XVI. für ein "bewegendes Fest des Glaubens". Bei einem Empfang im Anschluss an den Gottesdienst mit 61.000 Gläubigen im Olympiastadion Berlin am 22. September 2011 dankte Woelki auch all den vielen Menschen, "die mitgewirkt haben, dass wir an diesem Ort in solch würdiger und festlicher Weise miteinander das Geheimnis unseres Glaubens feiern konnten".