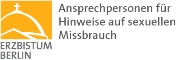Gut gelaunt empfängt Maximilian Wonke seine Gäste aus der Pfarrei Heiliger Christophorus Barnim im digitalen Wohnzimmer. Seit 2018 ist der SPD-Politiker Bürgermeister von Panketal. Die Gemeinde im Landkreis Barnim umfasst die Ortsteile Schwanebeck und Zepernick, deren Bebauung in den Berliner Ortsteil Buch übergeht. Und weil die Panke, ein Nebenfluss der Spree, die Gemeinde durchquert, „wurde sie Panketal genannt“. Maximilian Wonke, 1987 in Berlin-Buch geboren, Vater von drei Söhnen, hat an der Humboldt-Universität Agrarwissenschaft studiert hat. „Dort habe ich das eine oder andere Bier mit lebenslustigen Theologiestudenten getrunken“, sagt er und lacht. Er selbst sei nicht konfessionell gebunden, doch die Frage, ob er sich mit Engagierten aus der Pfarrei Hl. Christophorus, zu der „sein“ Panketal gehört, über ein Bibelwort unterhalten würde, habe ihn „gefreut“.
Die Gesprächsreihe „Kirche zu Gast bei…“ gehört zum Projekt „Digitale Gastfreundschaft“ des Erzbistums, das vom Bonifatiuswerk gefördert wird. Die Idee: Engagierte aus Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens sind zu Gast bei Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft, lernen deren Haltung, ihre „Berufung zur Tat“ kennen und die aktuellen Herausforderungen für die Kommune. Im Austausch bringen sich Christinnen und Christen mit ihrer Sichtweise, ihrem Engagement, ihren Fragen ein. Im Gespräch könnten „Ideen für den Beitrag von Kirche im Netzwerk des Sozialraums“ entwickelt werden, hofft die Sozialarbeiterin der Pfarrei Hl. Christophorus Andrea Baro, die beim Pilotprojekt Soziale Arbeit in der Pastoral mitarbeitet.
Im Gespräch mit dem Bürgermeister geht es um Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Sieben Themen aus den Sonntagsevangelien der Fastenzeit hatte Andrea Baro ihm zur Wahl gestellt: „Da war ‚Wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht‘ dabei, und Herr Wonke sagte spontan: ‚Das nehme ich, das ist meins‘.“
Seinen Impuls zum Thema beginnt er mit einem Zitat des Philosophen Voltaire: „Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.“ Es gibt also Situationen, in denen ein politisch Verantwortlicher die Wahrheit kennt, sie aber nicht veröffentlicht? Maximilian Wonke nennt ein Beispiel: Am 17. November 2015 sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande in Hannover wegen „ernstzunehmender Hinweise“ auf einen Terroranschlag ab. Er erläuterte diese „Hinweise“ aber nicht, weil sie die Bevölkerung verunsichert hätten, wie er argumentierte. „Das war wahr, sorgte aber für Unruhe, und der Minister wurde gescholten. Ich fand es aber gut.“
Dass eine 100-prozentige Transparenz bei Entscheidungen nicht immer möglich sei, gibt die Leiterin der Einrichtung Vita Domus Berlin-Karow zu bedenken: „Wenn zum Beispiel eine obdachlose Frau mit Wahnvorstellungen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss, weil Leib und Leben in Gefahr sind, kann ihr das zu diesem Zeitpunkt gar nicht erklärt werden.“ Eine Sozialarbeiterin aus der Suchtberatung stimmt ihr zu: „Der Weg zur Wahrheit ist schwer.“
Was mitunter auch für kirchliche Gremien gelte, fügt Uta Bolze vom Erzbistum hinzu. Sie gehört zu den Expertinnen und Experten aus Pastoral, Multimedia, Fundraising sowie der Kirchlichen Organisations- und Personalentwicklung, die das Projekt „Digitale Gastfreundschaft“ begleiten. „Im Pfarrgemeinderat sitzen auch Vertreter bestimmter Gruppen, etwa der Senioren oder der Jugendlichen, die ja gewählt wurden, um Gruppeninteressen zu vertreten und für ihren Bereich einen Informationsvorsprung haben. Ob da immer alle Pro- und vor allem auch die Contra-Argumente auf den Tisch kommen?“
Bürgermeister Wonke spricht in diesem Zusammenhang vom „Informationsmonopol“, das er von Amts wegen für Panketal und damit einen großen Vorteil habe: „Ich muss nicht nach Aufmerksamkeit gieren wie in Parlamenten oder bei Facebook.“ Er könne und er müsse die Risiken benennen, die eine Entscheidung mit sich bringt: „Wenn ein Projekt nach aktuellem Kenntnisstand zu 95 Prozent gut laufen wird, darf ich nicht 100 Prozent vorspielen und die fünf Prozent Restrisiko verschweigen. Das wäre unlauter.“ Und ja, „da gibt es auch das Scheitern, auch damit muss ehrlich umgegangen werden“. Mit Halbwahrheiten könne man weder Probleme lösen noch den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden.
Mit diesen Herausforderungen sei auch die Pfarrei mit ihren Gemeinden St. Peter und Paul Eberswalde, Herz Jesu Bernau, Mater Dolorosa Berlin-Buch, St. Konrad Wandlitz sowie den Orten kirchlichen Lebens konfrontiert, betont die Sozialarbeiterin der Pfarrei: die Zuzugsachsen Berlin-Panketal-Wandlitz und Berlin-Bernau-Eberswalde, der Umgang mit den Zugezogenen, die Einsamkeit im ländlichen Raum, die Seniorenarbeit, die Situation von Pflegebedürftigen sowie ihrer Angehörigen oder die Vernetzung der sozialer Einrichtungen aller Träger. Daher ihre Frage an den Kommunalpolitiker, wie er denn „uns als Kirche gebrauchen“ könne.
„Zunächst beglückwünsche ich Sie zur erfolgreichen Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg in Ihrer Pfarrei“, entgegnet der Bürgermeister von Panketal an der Grenze zu Berlin-Buch. Ein die Landesgrenzen überschreitendes Agieren sei anstrengend, „ist aber ein Riesengeschenk, das Sie da haben“. Die Kirche sehe er als eine wichtige Sozialpartnerin, die unterschiedliche Personengruppen zusammenbringe, eine Mediatorenrolle bei gesellschaftlichen Konflikten habe und durch ihre sozialen Einrichtungen sowie das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder die Kommune entlaste, zählt Maximilian Wonke auf. Dadurch habe die Kirche eine Vorbildfunktion - wie die Freiwillige Feuerwehr von Panketal: „Wenn’s brennt, springen die Feuerwehrleute auch nachts aus dem Bett oder verlassen die Geburtstagsfeier. Sie tun‘s einfach, weil sie sich verantwortlich fühlen. Genauso wie sich Mitglieder Ihrer Pfarrei ehrenamtlich für andere einsetzen. Ich ziehe den Hut vor allen, die nicht nur etwas für sich selbst erreichen wollen, sondern auch das Gemeinwohl im Blick haben.“
Diese Rolle der Kirche werde „hier im Osten“ manchmal vergessen oder übersehen, weil die Katholiken hierzulande eine Minderheit sind. „Natürlich ziehen auch katholische Familien nach Panketal, doch viele Panketaler wissen gar nicht, dass es hier Katholiken gibt, die sich für‘s Gemeinwesen einsetzen.“ Er plädiere daher für ein offensiveres Auftreten, etwa für mehr Präsenz in den Medien: „Stellen Sie Ihre Pfarrei und Ihre Projekte doch zum Beispiel im ‚Panketal-Boten‘ vor.“
Die Katholiken sollen also nicht so „lautlos“ sein? Manche der Online-Gäste schauen ungläubig. Uta Bolze, im Erzbistum für Fundraising zuständig, spricht es aus: „Ich leide daran, dass meine Kirche an manchen Stellen unwahrhaftig ist und ein schlechtes Image hat. Ist sie dadurch nicht mehr Belastung als Partnerin für die Kommune?“ - „Das haben Sie jetzt angesprochen“, sagt Maximilian Wonke und lächelt. Ja, es gebe besonders im Osten kirchenkritische Kräfte, doch werde das soziale Engagement der Gemeindemitglieder am Ort stärker wahrgenommen als die Institution Kirche. Wie alle Institutionen lebe auch die Kirche von Menschen, die wahrhaftig sind, „die sich mit offenem Herzen für hehre Ziele einsetzen und gegen den Strom der Individualisierung schwimmen“.
Und genügend Schnittmengen zwischen Pfarrei und Kommune gebe es ja, beispielsweise bei sozialen Themen. Eine Mitarbeiterin der Caritas bringt es auf den Punkt: „Wir müssen uns mehr vernetzen, damit jeder seine Schätze einbringen kann.“ Dabei gehe es nicht um „Christenfang“, sondern darum, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass alle sich wohlfühlen – die Alteingesessenen wie die Neuen.
In diesem Zusammenhang bringt der Bürgermeister seine Suche nach einem „Willkommensritual“ ein: „Wie kann die Kommune die Zugezogenen begrüßen, sie einbeziehen, wie machen Sie das mit den Neuen in Ihrer Pfarrei?“ Andrea Baro sieht Parallelen zur kirchlichen Willkommenskultur, bei der es „viel Luft nach oben“ gebe. „Da sollten wir doch gemeinsam überlegen“, schlägt Maximilian Wonke vor.
Gefragt, was er als Bürgermeister aus dem Gespräch mit seinen „digitalen Gästen“ mitnehme, nennt er das gewachsene Verständnis füreinander und dass er die Kirche besser wahrnehmen werde in seiner Arbeit. „Ich hoffe, dass wir öfter miteinander reden und Sie als Pfarrei präsent sind in der Kommune. Und ich danke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit.“ Vielleicht zeigt es sich ja: Wer die Wahrheit sucht, dem geht ein Licht auf.