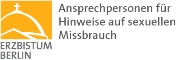Am vergangenen Sonntag ist vielerorts der Kranken gedacht worden. Jacqueline Liebig, Gottesdienstbeauftragte in St. Wilhelm Berlin-Spandau, will den Krankheits-Begriff gern breiter fassen – und den kirchlichen Einsatz erhöhen.
Wer schon mal einen Radiogottesdienst im RBB gehört hat, kennt die Formulierung am Schluss, dass der Kranken, Älteren und Schwachen, die keine heilige Messe besuchen können, aus der Ferne gedacht wird. Dabei besteht ja durchaus die Möglichkeit der Nähe, nämlich indem die Kommunion dem Kranken dort gespendet wird, wo er sich aufhält. Mit der Krankenkommunion kann die sakramentale Verbindung zwischen ihm und seiner Gemeinde gepflegt werden – im Beisein der Familie, die mitkommunizieren darf.
Dennoch wird die Krankenkommunion sehr selten beantragt, erzählte mir mal eine langjährige Kommunionhelferin in meiner Gemeinde St. Wilhelm Spandau. Gemeinsam haben wir uns gefragt, woran das liegt.
Beeinträchtigungen sind nicht nur körperlich
Zunächst gilt es sich klazumachen: Wer ist überhaupt ein „Kranker“ oder „Schwacher“? Wer wird dazu gezählt, und von wem? Wer gesteht sich seine Krankheit ein, und wer möchte sich selbst so vor anderen bezeichnen? Zu Zeiten Jesu zählten zu Krankheiten zum Teil andere als heute.
Neben sichtbaren Erkrankungen und Beeinträchtigungen, die wir Außenstehenden wegen eines Rollstuhls oder Rollators wahrnehmen, gibt es viele nicht sichtbare Beeinträchtigungen wie etwa der Tod eines Angehörigen und die verbreitete Sitte etwa, anderen in seiner Trauer nicht zu Last fallen zu wollen.
Der „Burnout“, bei dem man in der Woche an einem Arbeitsplatz mit niedriger Personaldecke noch irgendwie funktionieren muss, um sein Auskommen zu bestreiten. Am Wochenende ist dann aber nur noch Ausruhen angesagt, und selbst der Weg zur Kirche fällt schwer.
Da ist jener, der trotz Arbeit arm bleibt, wo dauernder Mangel und Armut und der daraus resultierende gesellschaftliche Status zu einer Psychokrise führt. Diese Depression hält Menschen davon ab, sich in die sozial und wirtschaftlich so ungleiche Gemeinschaft der Gläubigen zu begeben. Und wenn doch, dann treffen arme und reiche Christen zwar im Kirchengebäude aufeinander, aber nur selten danach im Alltag.
Und zu guter Letzt gibt es da sowohl die Missbrauchsopfer als auch die Corona-Langzeitgeschädigten, die sich mit begrenzter Kraft durch den Alltag quälen und auf Heilung und Hilfe warten, die oft ausbleibt.
Liturgie kann missverständlich sein
Bestimmte Teile der Liturgie können die Problematik noch verstärken, etwa wenn es in der heiligen Messe heißt: „Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und so wird meine Seele gesund.“
Der psychologische Nachklang solcher Sätze sollte nicht unterschätzt werden. „Nicht würdig sein“: Theologisch und liturgisch mag das stimmen, doch was bedeuten diese Glaubenssätze für Menschen, die täglich erleben, nicht würdig zu sein, deren Würde verletzt wurde, die in unwürdigen Lebens- und Arbeitsverhältnissen ausharren müssen? Oder „Dass du unter meinem Dach gehst“: Wer traut sich da, die Kommunion, also Jesus, in die eigene Wohnung einzuladen?
Fernbleiben der Messe psychisch bedingt?
Und was ist mit der im Katechismus verankerten Sonntagspflicht, die bei Nichteinhaltung nach wie vor als schwere Sünde gilt? Die Nichtteilnahme an der heiligen Messe liegt wohl eher selten in einer Haltung der Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung gegenüber Gott und seiner Kirche begründet. Das geschieht erst im zweiten Schritt, wenn man sich nicht gesehen oder aufgehoben fühlt, wie beim Samariter.
Wie ist nun das Verhältnis vom Recht auf Krankenkommunion und der Sonntagspflicht? Ich finde, es sollte neu in den Gemeinden diskutiert werden. Krankheit, Behinderungen und Leiden sind heute andere als damals. Durch Corona-Krankheitsfälle mit Langzeit-Folgeschäden in der eigenen Familie ist mir noch bewusster geworden, wie wichtig es ist, dass wir all jene Menschen nicht vergessen und ihnen die Nähe Jesu bringen, mit ihnen beten oder einfach da sind für einen kleinen Moment.
Vor der Mission erst die eigenen Leute erreichen
Am 11. Februar wurde wieder der Kranken gedacht. Denken wir doch öfter an sie auch im Alltag und besuchen wir sie mit der Krankenkommunion. Denken wir diesen Kreis der Kranken größer und nehmen all jene, die mühselig und beladen sind, noch mit hinzu. Diese Hausbesuche sind wichtig für die Betroffenen selbst, jene, die sie besuchen, aber auch für die Kirche.
Eine berührende Kirche sollte – bevor sie missioniert – „ihre“ Christen nicht übersehen, die schon da sind und in der Traurigkeit und Verlassenheit des Alltags leben. Der persönliche Kontakt, die Berührungen sind wichtig. Alles andere ist nicht glaubwürdig.
Ich wünsche mir eine Kirche, wie sie der Schriftsteller Khalil Gibran in einem Gedicht ausdrückt: „Ihr sollt nicht eure Flügel falten, damit ihr durch Türen kommt, noch eure Köpfe beugen, damit sie nicht gegen eine Decke stoßen, noch Angst haben zu atmen, damit die Mauern nicht bersten und einstürzen, ihr sollt nicht in Gräbern wohnen …“
Wir sollen leben, durch Jesus in ihm und mit ihm. Er richtet auf, lässt uns atmen, holt aus Dunkelheiten, heilt und berührt. Bringen wir diesen Jesus in die Häuser aller, die ihn brauchen!