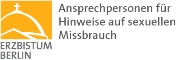Seelsorge hinter Gittern: „Ich bin für die Menschen da“, betont die Steyler Schwester Annette Fleischhauer. „Für alles andere sind Richter und Staatsanwälte zuständig.“ stadtgottes war zu Besuch bei ihr im Frauengefängnis in Berlin-Lichtenberg
Mit Handschlag hat Schwester Annette Fleischhauer jede einzelne Frau in Empfang genommen. „Der Gottesdienst will Ihnen Kraft schenken für den Alltag und Ihnen zeigen: Gott ist da“, begrüßt die Steyler Missionsschwester die Besucherinnen, die sich einen Platz in den Stuhlreihen gesucht haben. Szenen eines ganz gewöhnlichen Gottesdienstes – wären da nicht die Gitter vor den Fenstern und die beiden Vollzugsbeamtinnen. Sie haben die meisten der Inhaftierten des Frauengefängnisses in Berlin-Lichtenberg vom Aufnahmetrakt in den großen Saal mit den hohen Decken begleitet. Nun sitzen sie direkt neben der Tür. Ein schlichtes Holzkreuz, eine aufgeschlagene Bibel und zwei Ikonen sind auf dem Tisch, der an diesem Sonntagnachmittag als Altar dient. Ein Blumenstrauß und bunte Tülltücher sorgen für ein wenig Farbe. Und Schwester Annette: Die 59-Jährige ist zierlich, das leicht gewellte kurze Haar schlohweiß. Über der Albe, dem langen cremefarbenen liturgischen Gewand, hat sie ein pinkfarbiges Seidentuch um den Hals gebunden.
Die Gefängnisseelsorgerin arbeitet seit rund drei Jahren hinter Gittern, hat für die Sorgen und Nöte der Frauen ein offenes Ohr, egal ob beim Kirchencafé nach dem Gottesdienst, im Einzelgespräch in ihrem Beratungszimmer oder auf dem Gefängnisgang, hinter dem die Zellen liegen. Rund 220 Frauen sitzen in Berlin an insgesamt vier Standorten hinter Schloss und Riegel, knapp 100 sind es im geschlossenen Strafvollzug in der Lichtenberger Justizvollzugsanstalt, die meisten wegen Drogendelikten oder Beschaffungskriminalität. Wer neu ins Gefängnis kommt, ist zunächst für eine kurze Zeit in der Aufnahmestation untergebracht, kann rund zwei Stunden pro Tag die Zelle verlassen, sonst bleibt die Tür geschlossen. Später dann, wenn sie in den Wohngruppen leben, arbeiten die meisten Frauen von sieben Uhr in der Früh bis 15 Uhr nachmittags, beispielsweise in der Gärtnerei, Malerei, einem Fortbildungsprogramm oder der Bibliothek, helfen beim Essenverteilen oder bei der Wäsche. Wer jünger als 27 Jahre ist, kann unter bestimmten Bedingungen auch seinen Schulabschluss machen. Nach Feierabend ist „Aufschluss“: In der Regel bleibt die Zellentür dann bis 21 Uhr offen.
„GOTT HÄLT DICH IN SEINER HAND“
Schwester Annette hat im Gottesdienst von Umkehr, neuen Wegen und der Nähe Gottes gesprochen. Zwei Tage später sitzt ihr Ivana Maric in einem der beiden hellen Korbsessel im Büro gegenüber. Im Wandregal stehen Bibel, Anselm-Grün-Bücher neben Aktenordnern. Auch eine Ikone ist da. An der Pinnwand über dem Korbstuhl hängt eine Postkarte, auf der ein roter Marienkäfer zu sehen ist. Er baumelt an der Blattunterseite: „Gott hält dich in seiner Hand, auch wenn die Welt kopfsteht“ ist darauf zu lesen. Ivana Maric, die eigentlich anders heißt, ist 48 Jahre. Sie wirkt älter. Die langen braunen Haare hat sie streng zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
Zwei Jahre lang sitzt sie schon in Haft, weitere zwei Jahre liegen noch vor ihr. In der Lichtenberger JVA macht sie eine Umschulung. Für Ivana Maric, deren Eltern einst aus Slowenien nach Deutschland gekommen sind, eine „Chance, die Zeit zu nutzen“. Viermal im Monat bekommt sie Besuch. Eine Stunde lang kann sie dann mit ihren Eltern, ihrem 19-jährigen Sohn oder einem Freund reden. Ein langersehnter Lichtblick in der Einsamkeit und dem Gedankenkarussell aus Schuld, Scham und Selbstvorwürfen. Offen reden kann und will sie nicht mit den anderen inhaftierten Frauen. Es sei „eine Zwangsgemeinschaft“, sich jemandem wirklich anzuvertrauen, das gehe nicht.
PRIVAT HATTE IVANA MARIC VIELE SCHICKSALSSCHLÄGE
Ivana Maric fi ndet im Glauben Halt. Schwester Annette ist ihre „Glaubensschwester“, wie sie sagt, und für einen kurzen Moment huscht ein Lächeln über ihr sonst so ernstes Gesicht. Sie ist „die Einzige, bei der ich das Gefühl habe, dass sie mich versteht“. An ihre Tat kann sich Ivana Maric nicht erinnern. Immer noch nicht, auch nach mehr als zwei Jahren nicht. „Filmriss“, sagt sie. Sie hatte gerade erst ihren Lebensgefährten verloren, mit dem sie eigentlich alt werden wollte. Viel Zeit, über seinen Krebstod zu trauern, blieb ihr nicht. Denn ihr dementer Vater erhielt ebenfalls die Diagnose Krebs. Ihren Schmerz und ihre Hilfl osigkeit versuchte sie durch Alkohol zu betäuben. Zeit für eine Therapie nahm sie sich nicht. Sie wollte für ihren geliebten Vater dasein, bei dem sie auch aufgewachsen war. Wie es zu der Tat kam? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur, dass sie als vermindert schuldfähig verurteilt worden ist. Doch ihr Gewissen quält sie, das ist deutlich. Als Katholikin glaubt sie zwar, dass Gott ihr verzeiht. Sie selbst kann sich aber nicht verzeihen: „Ich bin dem Teufel in die Falle getappt“, sagt sie. Nur Gott wisse, „wie sehr ich den Tod meines Vaters bereue.“
DIE FRAUEN SPRECHEN ÜBER IHRE FAMILIE
Wer wie Ivana Maric Schwester Annette sein Herz ausschüttet, weiß: Sie hat Zeit. Für viele Inhaftierte ist ihr Büro wie eine Ruheoase. Dabei geht es in den Gesprächen oft gar nicht um Gott. Meist reden die Frauen über ihre Familie: von ihren Kindern, die ohne ihre Mutter aufwachsen, oder von Beziehungen, die in die Brüche gehen. Anders als Sozialarbeiter hat Schwester Annette bei den Gesprächen kein Ziel vor Augen, muss die Inhaftierten nicht beurteilen, nicht entscheiden, wie es für sie nach der Haft weitergehen soll. „Bei den Sozialarbeitern achten die Frauen viel mehr darauf, wie sie sich verhalten“, erklärt Schwester Annette. Sie fragt nicht danach, warum eine Frau hinter Schloss und Riegel sitzt. Sie urteilt – und vor allem – sie verurteilt nicht: „Ich bin für die Menschen da“, betont sie, „für alles andere sind Richter und Staatsanwälte zuständig.“
Immer mehr merke sie, wie wichtig es sei, „einfach nur zuzuhören“. Es komme öfter vor, dass ihr eine Frau für das gute Gespräch gedankt habe. „Dabei habe ich kaum etwas gesagt.“ Und: Schwester Annette unterliegt dem Seelsorgegeheimnis. Kein Wort von dem, was mit ihr besprochen wird, dringt nach außen. Nicht zu den anderen Missionsschwestern, mit denen sie im Ostberliner Bezirk Marzahn zusammenlebt, nicht mit den Kollegen, die sie regelmäßig alle sechs Wochen zum fachlichen Austausch trifft. Aber mit Gott redet Schwester Annette, wenn sie Gespräche nicht loslassen, ihr Begegnungen auch nach Dienstschluss nicht aus dem Kopf gehen. „Guter Gott“, betet Schwester Annette dann, „ich habe getan, was ich tun konnte, jetzt musst du den Rest machen.“
Wie beim Gottesdienst. Warum die Frauen gekommen sind? Weil es eine Abwechslung vom tristen Knastalltag ist, das Kirchencafé im Anschluss interessiert oder es eine Auszeit für die Seele ist? So genau können die zumeist jungen Frauen das wohl selbst nicht sagen. Was sie aber zumindest alle wollen: eine Kerze anzünden für ihre Angehörigen. Einzeln treten einige nach vorne vor den Altar, andere in Zweier- oder Dreiergruppen. Manche zünden einfach nur das Teelicht an, andere verharren einen kurzen Moment in der Stille. Was ihnen durch den Kopf geht, wissen nur sie selbst. Doch mit jeder Kerze wird es ein wenig heller.