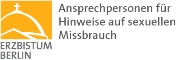Im August vor 50 Jahren kam es in dem von Afroamerikanern bewohnten Armenviertel von Los Angeles zu einem Gewaltausbruch, der sechs Tage lang andauerte. 34 Menschen wurden getötet, mehr als tausend verletzt.
Eine Kommission, die den Kampf zwischen Schwarzen und Weißen untersuchte, kam zu dem Schluss, dass die Morde und Brandstiftungen vor allem in der Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung ihren Grund hatten.
Nur zwei Jahre zuvor, im August 1963, hatte der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede gehalten, in der er zum Ende jeglicher Rassendiskriminierung und zum friedlichen Zusammenleben aufrief: "I have a dream … Ich habe einen Traum, - dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird“.
Martin Luther King wollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass Unrecht und Gewalt unter den Menschen überwunden werden könnten, und dass niemand wegen seiner Herkunft oder Hautfarbe diskriminiert wird.
Unsere Stadt kennt solche Rassenprobleme nicht. Im Gegenteil. Berlin rühmt sich des Öfteren für seine funktionierende Multikultur. Und tatsächlich gibt es hier viel gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz.
Aber es gibt eben auch noch die Vorurteile und die Diskriminierung – im Beruf, auf dem Schulhof oder bei der Wohnungssuche. Auch viele Christen aus den katholischen Ausländergemeinden können darüber berichten, wie negative Klischees zu Hindernissen werden und das tägliche Leben schwer machen.
Multikultur ist eben mehr als türkisch zu Essen, den Karneval der Kulturen zu feiern oder Yoga-Kurse zu absolvieren.
Sie bedeutet, trotz mancher Unterschiede nicht nur nebeneinander, sondern miteinander zu leben. I have a dream …