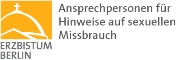Unterbrechung
Impuls zur Wochenmitte
Hoffnung ist eine der großen Botschaften des Christentums. Warum sie glauben und auf ein Mehr hoffen, erzählen hier Christinnen und Christen. Persönliche Glaubenszeugnises und mutmachende Gedanken in der Wochenmitte, um die Seele aufzutanken.
15. November 2023
Dafür nehme ich mir Zeit
Das Ziel meines Lebens ist nicht, irgendwann einmal alles geschafft zu haben. Die Frage ist eher, was in meinem Leben so wichtig ist, dass es keinen Aufschub duldet. Was mein Herz berührt, was mich im Innersten erfüllt, dafür nehme ich mir Zeit. Alles andere darf heute mal warten.
Pfarrer Martin Kalinowski
08. November 2023
Genau da wohnt Gott
Wo Liebe einen Platz hat, wo unsere Türen offen stehen für den anderen, wo wir der Hoffnung ein Dach über dem Kopf geben und uns in Frieden um einen Tisch versammeln, da ist Gott zuhause. Da werden unsere vier Wände zum Himmel.
Christoph Kießig
Dipl. Sozialpädagoge
01. November 2023
"Der Sieg des Guten"
An Allerheiligen feiern Christen all die Menschen, die in ihrem Leben etwas Gutes verwirklicht haben. Sie haben durch ihre Liebe zu anderen Menschen und ihren Glauben an Christus gezeigt: Das Gute kann stärker sein als das Böse und das feiern wir an Allerheiligen: Den Sieg des Guten.
Mario Junglas
Sprecher der "Worte auf den Weg"
25. Oktober 2023
"Mit Dankbarkeit in den Tag starten"
Aller Anfang ist manchmal schwer. Auch der Wochenanfang. Ich frage mich, wie ich gut in den Tag starten kann. Es klingt vielleicht seltsam, wenn ich sage, dass mein Ich sich bei all meinem morgendlichen Tun noch im Tiefschlaf befindet. Wie also könnte ich mein Ich wecken? Wenn ich in Dankbarkeit über die Natur und die Sonnenstrahlen am Morgen bewusst meinen Tag beginne, wird mein Inneres berührt, geweckt und zum Vorschein gebracht werden.
Frank-Peter Bitter
Polizeiseelsorger im Erzbistum Berlin
18. Oktober 2023
"Die täglichen Bilder erschüttern mich. "
Krieg, Gewalt und Hass. Die täglichen Bilder erschüttern mich. Meine Sorge vor einem Flächenbrand wächst Und ich frage mich: Was kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen, dass die Erde ein friedlicher Ort ist, auf der wir gerne leben? Von meiner Hoffnung lasse ich nicht ab, dass es eine friedvolle und gerechte Welt gibt.
Christopher Maaß
Kirchlicher Organisationsberater im Erzbistum Berlin
11. Oktober 2023
"Der Gedanke ist der Anfang von allem"
Tolstoi sagte einmal:
„Der Gedanke ist alles. Der Gedanke ist der Anfang von allem. Und Gedanken lassen sich lenken. Daher ist das Wichtigste: Die Arbeit an den Gedanken.“
Wenn wir herbstlich-trübe Gedanken haben, sollten wir also die Hoffnung immer im Blick behalten, damit es in unseren Herzen hell werden und auch bleiben kann.
Patricia Fügener
"Abendsegen"-Sprecherin
04. Oktober 2023
"Mich ihm anvertrauen"
Der Schutzengel hilft mir, nicht den falschen Weg einzuschlagen. Dazu muss ich ihm vertrauen, mich ihm anvertrauen. Er begleitet mich und ist wie ein Band zwischen mir und Gott; er kennt das Ziel meines Weges.
Hildegard Stumm
Sprecherin der "Worte auf den Weg"
27. September 2023
"Er lässt mich so sein, wie ich bin"
Gott ist Bewahrer seiner Schöpfung, und wenn er mich so sein lässt, wie ich bin, weil es an mir nichts besser zu machen oder zu reparieren gibt, dann ist das eine Einsicht, über die ich mich freue.
Christina Förner
"Abendsegen"-Sprecherin
20. September 2023
"Dankbar sein für Kleinigkeiten"
Manchmal nehme ich mir bewusst vor innezuhalten und zu fragen, wem ich dankbar sein kann. Dankbar für Kleinigkeiten, über die ich sonst achtlos hinweggehe: Menschen, die sich um mich sorgen, an mich denken oder für mich beten. So wirkt Gott für mich in der Welt.
Christopher Maaß
Kirchlicher Organisationsberater im Erzbistum Berlin und
Prozessbegleiter im Pastoralen Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“
13. September 2023
"Pausenlos im Einsatz sein, das geht nicht."
Auch die Menschen in biblischen Zeiten brauchten so etwas wie Urlaub: Da sehnt sich ein Psalmbeter nach einer Flugreise, eine Frau gönnt sich ein Wellnessbad, und Jesus versucht, sich vor den Menschenmassen zurückzuziehen. (...) Mitunter hat er den ganzen Wirbel um seine Person satt und will einfach mal für sich sein, weiß das Matthäus-Evangelium: „Und er fuhr von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein" (Mt 14, 13). Eins ist völlig klar: pausenlos im Einsatz sein, das geht nicht. Damals nicht und heute auch nicht.
Hans-Joachim Ditz
Ökumene-Referent im Erzbistum Berlin