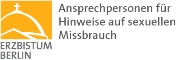Interview mit Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky
Es war immer schwerer als ich erwartete,
aber die Gnade war auch immer größer
Herr Kardinal, haben Sie Ihre Zusage, sich von Gott als Priester in den Dienst nehmen zu lassen, auch manchmal bezweifelt oder in Frage gestellt?
Georg Kardinal Sterzinsky: Bedacht ja, bezweifelt nein! Wir haben uns im Weihekurs anlässlich des 50-jährigen Weihejubiläums zu einem Einkehrtag getroffen. Manche haben eingestanden: »Wenn ich damals schon gewusst hätte, was alles auf mich zukommt ...«. Die Situation hat sich oft verändert. Als wir mit dem Studium begannen, hat keiner an ein Konzil gedacht. Vor der Weihe wussten wir: Ein Konzil kommt, aber keiner ahnte, was es in Bewegung setzen würde. Die Aufgaben und Herausforderungen waren immer wieder andere, auf die wir nicht wirklich vorbereitet waren, auch nicht vorbereitet sein konnten, bis hin zur Wiedergewinnung der Einheit Deutschlands. In jeder dieser Situationen habe ich mich gefragt: Ist es das, wofür ich mich habe weihen lassen? Und jede dieser Situationen hat erneut ein bewusstes »Ich bin bereit« erfordert. Aber immer neu habe ich auch die Erfahrung gemacht: Wenn ich mich auf die Anforderungen eingelassen habe, wenn ich mich in den Dienst nehmen ließ, wurde mir die Kraft gegeben, ihn auch recht und schlecht zu erfüllen. Es war immer schwerer als ich erwartete, aber die Gnade war auch immer größer. Wie es mein Wahlspruch als Bischof sagt: Deus semper maior.
Hatten Sie es vor 50 Jahren einfacher als ein junger Mann, der sich heute für den Priesterberuf entscheidet?
Georg Kardinal Sterzinsky: Ja, wir hatten es einfacher. Erstens gab es in der DDR eine Konfrontation mit dem Staat. Die Partei hatte ganz klar erklärt: Die Kirche werden wir vernichten! Und wir jungen Leute haben uns gesagt: Das lassen wir uns nicht gefallen, wir bieten euch die Stirn! Eine solche Konfrontation ist eine Herausforderung, die stärkt. Zweitens hatten wir in den Pfarreien Gemeindemitglieder, die sagten: Wir brauchen die Priester, wir brauchen den priesterlichen Dienst. Sie haben auch erwartet, dass die Priester ihrer Berufung entsprechend leben. Diese Erwartung hat uns natürlich auch motiviert, so zu leben. Aber sie haben nicht gesagt, weil die Priester so leben, wie sie vorgeben zu leben, schätzen wir sie, sondern sie haben gesagt: Der priesterliche
Dienst ist uns so viel wert, dass wir die Priester schätzen. Das ist heute anders. In vielen Gemeinden ist die Haltung zu beobachten: Wenn der priesterliche Dienst ausfällt, dann fällt er halt aus, und dann wird er eben ersetzt durch etwas anderes. Das ist ganz schwierig für jeden, der vor der Frage steht, Priester zu werden oder nicht, wenn es anscheinend auch ohne Priester geht.
Sonntagsgottesdienst als stärkende Erfahrung
Sie haben gesagt, dass schwere Zeiten hinter Ihnen liegen. Sie hatten aber als Pfarrer in Jena, in der größten Gemeinde der DDR mit rund 10.000 Gläubigen, gut 2.000 Gemeindemitglieder, die Sonntag für Sonntag zu den Gottesdiensten gekommen sind. Gibt es aus dieser Zeit Erfahrungen, die Sie stark gemacht haben?
Georg Kardinal Sterzinsky: Ja, jeder Sonntagsgottesdienst war so eine Erfahrung. Am Sonntagvormittag feierte ich in Jena vier Gottesdienste hinter ein ander, und jedes Mal war die kleine Kirche überfüllt. Man merkte es den Menschen an, dass es ihnen ein Bedürfnis war, Gott zu loben, der Predigt zu lauschen. Wenn man das Sonntag für Sonntag erlebt, so stärkt das einen. Man ist eigentlich die ganze Woche am Überlegen: Was kann ich den Menschen sagen, das sie stark macht in der Woche, im Glauben zu bleiben, zu beten, in Verbindung miteinander zu bleiben, das karitative Engagement der
Gemeinde fortzusetzen, ihre Kinder im Glauben zu erziehen. Diese Frage hat mich motiviert. Und dann gab es die Unterstützung durch Einzelne, die mich gestärkt hat. Mein Vater zum Beispiel, der hat die Auseinandersetzung mit Staat und Partei noch mehr ausgefochten als ich. Mein Vater durfte nie Betriebsleiter in der Ziegelei werden, in der er arbeitete, aber man fand auch keinen Fachmann, also war er über Jahre kommissarischer Betriebsleiter. Dann sprach es sich im Betrieb herum: Der Sohn wird in einem halben Jahr Primiz haben, also nach der Priesterweihe den ersten Gottesdienst
in seiner Heimatgemeinde feiern. Und dann beschloss die Partei – natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit – an dem Tag, an dem der Sohn hier den Gottesdienst feiert und sich der Vater nicht vom Sohn distanziert, wird er auch diesen Posten loswerden und Hilfsarbeiter werden. Zwanzig Minuten nach dem Parteibeschluss wusste mein Vater davon. Und dann ist er denen zuvorgekommen und hat von sich aus gekündigt, was in der DDR ein Unding war. Danach war er arbeitslos. Später arbeitete er in einem Sägewerk als ungelernter Hofarbeiter. Das alles hat mein Vater für mich in Kauf genommen. Er hat gesagt: Ich werde mich von meinem Sohn nicht distanzieren. Ich hab ihn nicht gedrängt, Priester zu werden, ich hab ihn nicht einmal finanziell unterstützen können im Studium. Aber ich habe mich gefreut, dass er es macht. Da werde ich mich
doch nicht von ihm distanzieren, nur um diesen verrückten Posten eines kommissarischen Betriebsleiters in einer volkseigenen Ziegelei zu behalten. Diese
Haltung meines Vaters hat mich gestärkt.
Wie haben Sie die Rolle der katholischen Kirche zu DDR-Zeit gesehen?
Georg Kardinal Sterzinsky: Wie eine geschlossene Phalanx. Wir wussten: Wir können in der Gesellschaft nichts ausrichten, also gehen wir nicht auf Konfrontation. Denn die Konfrontation würde uns höchstens schaden. Wir werden den Staat nicht attackieren,
sonst passiert uns, was in der Sowjetunion passiert ist: Die Kirchen werden kassiert, geschlossen, wir müssen in den Untergrund gehen und dann wird es noch schlimmer. Oder es geschieht, was in der Tschechoslowakei geschehen ist, das würde uns
auch nicht helfen. Gleichzeitig wussten wir: Wir dürfen den Staat nie hofieren, nie eine ideologische Verbeugung machen, nie nachgeben in Fragen des Glaubens und Bekenntnisses, nie mitmachen, wo wir unseren Glauben auch nur scheinbar verlieren und verleugnen. Aber wir müssen stark bleiben für den Fall, wenn dieses verruchte System zusammenbricht. Und so war es dann auch: Als die Wende kam, waren
die Katholiken da!
Die Wende: eine spannende Zeit für Sie?
Georg Kardinal Sterzinsky: Eine sehr spannende und eine nicht leicht durchschaubare Zeit. Da war ich dann schon in Berlin, im September 1989 bin ich nach Berlin gekommen.
Als Sie 1989 nach Berlin kamen, hatten Sie eigentlich vor, sich auf die neue Aufgabe ruhig einzustellen, ein Jahr lang alles anzuschauen, zu beobachten. Doch dazu
kam es nicht.
Georg Kardinal Sterzinsky: Es ist eine gute Regel zu sagen: Wenn ich einen neuen Posten übernehme, mache ich ein Jahr lang alles wie der Vorgänger. Nur schauen und beurteilen, aber noch nicht anders handeln. Aber so konnte ich nicht vorgehen, ich musste alles gleich ändern.
Und ist Ihnen das aus Ihrer Sicht gelungen? Was haben Sie in der Wendezeit erreichen können?
Vorurteile zwischen Ost und West überwinden, voneinander lernen
Georg Kardinal Sterzinsky: Lange Zeit musste ich eine Konfrontation ertragen, eine Enttäuschung: Die Katholiken im Osten hatten gedacht, im Westen sei alles viel besser, wir brauchen es also nur so zu machen wie die Katholiken im Westen. Und nach nur wenigen Wochen merkten sie: Nein, das ist eine ganz andere Welt. So wollen wir nicht werden. Wir wollen es zwar so haben wie die Menschen im Westen, aber wir wollen nicht so werden wie sie. Und die im Westen guckten sich die Ostdeutschen an und sagten: Wir haben die für Helden gehalten, aber das sind sie ja gar nicht. Eine kluge Frau, die jüngst verstorbene Hanna-Renate Laurien, hat es auf die Formel gebracht: Die Westler denken, die im Osten sind doof, und die Ostler denken, die imWesten sind nicht fromm. Beides ist überspitzt, aber hat einen Anknüpfungspunkt in der Realität. Und jetzt müssen wir
vonein an der lernen: Die im Osten müssen lernen, dass Christen eine Verantwortung für die Gesellschaft haben, die sie nicht wahrnehmen, wenn sie sich einigeln und abschirmen. Und die im Westen müssen lernen, dass sie ihre Verantwortung für die Gesellschaft nicht wahrnehmen können, wenn sie nicht aus dem Glauben und aus der Frömmigkeit leben. Sie müssen sich um den Altar versammeln, aus dem Gebet, aus dem Wort Gottes leben. Und so ist mindestens dieses Vorurteil überwunden worden. Aber immer noch ist zu merken: Über Jahrzehnte gewachsene Mentalitäten werden auch nur über Jahrzehnte verwandelt, sie sind immer noch nicht ganz behoben. Allerdings hat sich die Bevölkerung gemischt. Aus dem Westen Berlins sind wenige in den Osten gezogen
und umgekehrt auch, aber es sind viele aus Westdeutschland nach Berlin gezogen. Dadurch hat sich vieles im Bewusstsein wie auch in der Gläubigkeit gewandelt.
Der Glaube weckt Kräfte
Wie sehen Sie die Rolle der katholischen Kirche heute? Es gibt ja immer weniger, die sonntags zum Gottesdienst kommen …
Georg Kardinal Sterzinsky: Es wächst langsam das Bewusstsein: Wir dürfen nicht nur bewahren. Denn wir bewähren uns nur, wenn wir nach außen hin unseren Glauben einladend, sogar missionarischleben. Und wir müssen auch sagen: Wir haben einen
Auftrag für die Gesellschaft. Der Glaube kann und muss heilende Kräfte in die Gesellschaft tragen. Im Augenblick sind wir in einer ganz schweren Krise, weil plötzlich etwas offenbar wurde, was zwar da war, aber kaum einer gewusst hat: sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch. Das müssen wir erst einmal aufarbeiten und überwinden. Das nimmt man der Kirche mit Recht übel, das darf es vor allem in der Kirche nicht geben, das darf es überall nicht geben, gibt es aber leider überall und zehnmal leider
auch in der katholischen Kirche. Die aktuelle Situation schwächt die Glaubwürdigkeit der Kirche. Es ist eine akute Krise, die wir überwinden müssen. Aber dann müssen wir wieder zeigen, dass der Glaube nicht nur dem hilft, der selbst glaubt, sondern dass
der Glaube auch Kräfte weckt, die der Gesellschaft heilende Kräfte zuführen.
Sie haben sich vor 50 Jahren zum Priester weihen lassen und damit für ein eheloses Leben entschieden. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung heute?
Georg Kardinal Sterzinsky: Als ich so zwanzig, dreiundzwanzig Jahre alt war, habe ich für mich akzeptiert, dass die Kirche es sich leistet, ihre Priester aus denen zu wählen, die zum ehelosen Leben berufen sind. Es gibt nach den Worten Jesu in der Heiligen Schrift Menschen, die sind zur Ehe berufen, und es gibt Menschen, die sind um des Himmelreiches willen zur Ehelosigkeit berufen. Die römisch-katholische Kirche hat sich vor rund tausend Jahren entschlossen, ihre Priester aus denen zu wählen, die zur
Ehelosigkeit berufen sind. Ich habe schon sehr bald, vom ersten Kaplansjahr an, junge Leute auf die Ehe vorbereitet, habe denen also sagen müssen, wie ich mir als Christ die Ehe vorzustellen habe. Dann kam ich zu der Einsicht, dass ich das als Priester nicht könnte. Ich würde der Frau, den Kindern, der Familie nie gerecht werden. Mein Fazit: Ich, für meine Person, kann keine Ehe leben. Also kann ich nicht anders, als um des
Himmel reiches willen, um des Priestertums willen ehelos zu leben. Ich kann nur zölibatär leben. Offensichtlich muss es auch andere geben, die zur Ehelosigkeit
um des Himmelreiches wegen berufen sind, und die Kirche wählt bis auf den heutigen Tag ihre Priester aus denen aus, die um des Himmelreiches willen zur Ehelosigkeit berufen sind. Wie lange sie dabei bleibt, weiß ich nicht. Aber sie sollte es nicht in
einer Krisenzeit ändern. Man deckt doch ein Dach nicht neu, während ein Gewittersturm tobt.
Innere Ruhe und Freude
Seit mehr als zwanzig Jahren sind Sie Bischof. Damit müssen Sie letztlich über die Berufung anderer Menschen entscheiden. Wie geht das?
Georg Kardinal Sterzinsky: Zum Glück muss ich das nicht alleine tun. Bevor ein Kandidat geweiht wird, beurteilen verschiedene Personen, ob er geeignet ist: die Professoren im Theologie-Studium, der Theologen-Referent, die Regenten der jeweiligen Priesterseminare, die Mentoren und Praktikums-Pfarrer. Sie alle wirken an dieser Entscheidung mit. Und auch der Kandidat ist gehalten, seine Neigung und Eignung immer neu zu prüfen. Dabei ist immer ganz wichtig, ob er auf seinem Weg zum Priestertum innere Ruhe und Freude gewonnen hat. Beides halte ich für diesen Dienst als unabdingbar. Auf Selbstsicherheit hingegen kommt es nicht an.
Früher sagte man oft formelhaft »Priesterleben – Opferleben«. Darf ein Priester überhaupt glücklich sein?
Georg Kardinal Sterzinsky: Das schließt sich doch nicht aus. Im Gegenteil: Glücklichsein ist die Probe aufs Exempel, ob er auf dem rechten Weg ist. Wer Opfer nicht als ein selbstauferlegtes Opfer begreift, sondern als die Annahme des Dienstes, zu dem
er gerufen ist, der wird darin sein Glück finden. Und umgekehrt: Wer meint, dass er glücklich wird, wenn er seinen Lebensplan durchsetzt, wird unglücklich. Selbstverwirklichung im Sinne Jesu besteht darin, das zu tun, wozu man berufen und gesandt ist. Je älter ichwerde, umso klarer finde ich bestätigt, was Jesus sagt:
»Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert,wird es retten.« Wer sich hingibt, wird glücklich.
Juliane Bittner
»… jede dieser Situationen hat erneut ein bewusstes ›Ich bin bereit‹ erfordert.«
Dieses Interview stammt aus dem anlässlich des 75. Geburtstages von Kardinal Sterzinsky erschienenen Buch "Erzbistum Berlin - Gesichter und Geschichten"
Dieses Buch wird am Donnerstag, 10. Februar 2010, 19:00 Uhr im Kathedralforum St. Hedwig vorgestellt. 18:00 Uhr besteht die Gelegenheit an der hl. Messe in der St. Hedwigs-Kathedrale teilzunehmen. mehr ...
»Was kann ich den Menschen sagen, das sie stark macht in der Woche, im Glauben zu bleiben …«
»Glücklichsein ist die Probe aufs Exempel …«